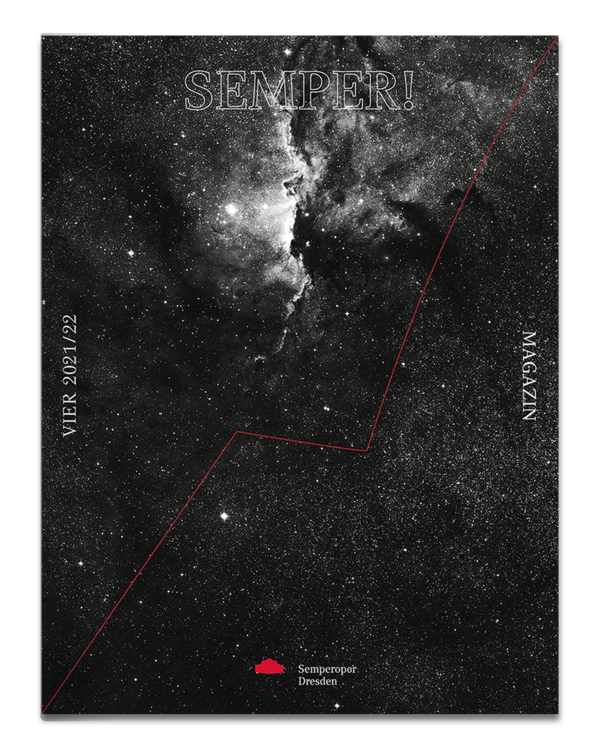»Semper!«-Magazin
VIER 2021/22
Vorwort
Liebes Publikum,
vor gut 150 Jahren, am 24. Dezember 1871, feierte Giuseppe Verdis Oper »Aida« im Khedivial-Opernhaus in Kairo ihre Uraufführung. Eindrucksvolle Arien, grandiose Massenszenen mit dem bekannten Triumphmarsch und Ballett, eine ausgefeilte Instrumentierung und ausdrucksvolle Melodien kennzeichnen dieses gewaltige Musikdrama. Ich freue mich sehr darauf, dieses Werk in der Regie von meiner verehrten Kollegin Katharina Thalbach nun erstmals in Dresden zu dirigieren!
Vor neun Jahren, im Frühjahr 2013, reisten die Staatskapelle und ich zum ersten Mal zu unserer Residenz bei den Osterfestspielen nach Salzburg. Nach bald neun erfolgreichen Festspiel-Jahrgängen an der Salzach empfinden wir große Dankbarkeit: für ein treues und begeistertes Publikum, für viele bewegende Begegnungen und musikalische Sternstunden. Mit Vorfreude blicken wir nun auf unsere letzten Festspiele: auf einen neuen »Lohengrin«, auf Konzerte mit Werken von Bruckner, Bartók und Richard Strauss’ »Alpensinfonie« – das Werk, mit dem Strauss in tief empfundener Freundschaft seinen »lieben Dräsdnern« ein musikalisches Denkmal setzte.
Vor knapp zwei Jahren, am 24. März 2020, sollte übrigens im Großen Festspielhaus in Salzburg die erste Orchesterprobe zur geplanten Neuinszenierung der Osterfestspiele, Giuseppe Verdis »Don Carlo «, stattfinden. Wie »Aida« heute, hatte ich »Don Carlo « noch nie dirigiert. Für mich persönlich schließt sich mit der aktuellen Neuinszenierung ein Kreis. Denn seither mussten wir alle – mehrfach! – schmerzlich erfahren, dass ein Virus alle Vorhaben und Pläne zunichte machen kann. Und wir mussten lernen, uns auf das zu besinnen, was uns verbindet und wofür wir stehen: das gemeinsame Erleben von Musik. Ich wünsche uns allen eine baldige Rückkehr in volle Konzertsäle. Alle können dazu einen Beitrag leisten.
Ihr
Christian Thielemann
Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle Dresden

Ansichten
Ansichten
Die andere Frau
Im Auftrag der Semperoper hat der Komponist Torsten Rasch gemeinsam mit dem Schriftsteller Helmut Krausser aus der biblischen Geschichte von Abram und seiner Frau Sarai ein Musiktheaterwerk entwickelt. »Die andere Frau« erzählt die Dreiecksgeschichte um die »Leihmutter« Hagar, die nach der Geburt von Sarais Sohn Isaak doch verstoßen wird. Die biblische Geschichte steht für die Entstehung der drei monotheistischen Weltreligionen, für Krieg und Frieden, Hass, Heimatverlust, Liebe und Toleranz.






Nahaufnahme
Nahaufnahme
Zugkraft
Ein Blick hinter die Kulissen: Der Schnürboden ist eine begehbare Zwischenebene über der Bühne, gemeinsam mit dem Rollenboden bildet er den Abschluss des Bühnenturms. In dieser Ebene befinden sich die Antriebsmaschinen, Seile und Umlenkrollen, die für das Anheben von Dekorationsteilen notwendig sind. In der Semperoper sind dies 42 Maschinenzüge, 22 Punktzüge (in einem bestimmten Raster für besondere Anwendungen positionierbar), vier Handzüge und drei Rundhorizontzüge. Diese Antriebe werden von den Mitarbeiter*innen der Maschinenabteilung über ein Computersystem gesteuert. Der Bühnenturm ist etwa doppelt so hoch wie der sichtbare Portalausschnitt, der den Zuschauerraum von der Bühne trennt. Diese Höhe ist notwendig, damit der Schnürboden und nicht benötigte Dekorationselemente für das Publikum nicht sichtbar sind.

Premiere
Mehr an Biss und Theatralik
Zum ersten Mal in dieser Konstellation und mit diesem Werk: Christian Thielemann, Katharina Thalbach und Ezio Toffolutti interpretieren Giuseppe Verdis große Ägypten-Oper »Aida« neu für die Semperoper
In der Semperoper stehen die Zeichen auf große Oper: Nachdem bereits im vergangenen Oktober Giuseppe Verdis »Don Carlo« in der Regie von Vera Nemirova auf die Bühne kam, folgt nun jenes Werk, dem der Komponist selbst im Vergleich zum »Don Carlo« ein »mehr an Biss und Theatralik« konzedierte: »Aida«. Christian Thielemann, Katharina Thalbach und der Bühnen- und Kostümbildner Ezio Toffolutti nehmen sich der herausfordernden Aufgabe an, ein Bühnenwerk für die Semperoper neu zu entdecken, das wohl wie nur wenige andere Opernwerke zum Mythos des Musiktheaters geworden ist.
Denn bereits die Uraufführung von »Aida« markiert einen bedeutenden Moment der Kulturgeschichte; fand diese doch in dem neu erbauten und gleichzeitig ersten Opernhaus auf dem afrikanischen Kontinent, in Kairo, statt, an Heiligabend 1871. Der Komponist selbst war nicht anwesend – zu ambivalent war wohl sein Verhältnis zu dem Kompositionsauftrag des ägyptischen Vizekönigs Ismael Pascha, dazu kam seine Skepsis Seereisen gegenüber. Dennoch war die Uraufführung ein sensationeller Erfolg – und kurz nach der von Verdi überwachten Mailänder Premiere 1872 wurde »Aida« international zu einem Zugstück des Repertoires. In den Jahren von 1874 bis 1876 raste das Werk gewissermaßen von Buenos Aires über Berlin, Wien, St. Petersburg, London, Paris und Dresden um die Welt, um 1901 in der Arena von Bayonne zum ersten Mal als Freilichtaufführung gezeigt zu werden. 1912 erfolgte die Aufführung vor den Pyramiden von Gizeh und 1913 wurde mit der Aufführung von »Aida« in der Arena von Verona anlässlich des 100. Geburtstages des Komponisten jener Gleichklang von Monumentalität, Italien und Verdi manifestiert, der noch heute fasziniert.
Aber warum komponiert ein italienischer Komponist eine Oper über das alte Ägypten? Spätestens seit Napoleons Ägyptenfeldzug von 1798 bis 1801 waren Ägypten und der afrikanische Kontinent in Europa en vogue: Forschungsreisende wie Stanley und Livingstone suchten die Quellen des Nils, Champollion gelang es, die Hieroglyphen zu entschlüsseln, Reisen nach Ägypten wurden für die, die es sich leisten konnten, populär ... Und ja, neben dem tiefen Eindruck, den der vielfältige Kulturraum auf die Intellektuellen, Kunst- und Kulturschaffenden ausübte, waren es vor allem auch ökonomische und geostrategische Machtinteressen, die im Zeitalter des Imperialismus zu massiven Landnahmen, Vereinnahmungen, Vermessungen und gewaltsamen Aneignungen führten. Der ägyptische Vizekönig Ismael Pascha war als westlich gesonnener Reformator in einem Doppelakt darum bemüht, selbst zum aktiven Gestalter der Zukunft Ägyptens – damals noch Teil des Osmanischen Reichs – zu werden. So wollte er die »Segnungen« Europas für Ägypten nutzbar machen, den mit der Ägyptomanie verbundenen Tourismus fördern und selbst als Kolonialmacht im südlichen Afrika expandieren: Ägypten also zu einem nach europäischem Vorbild gestalteten Nationalstaat formen. Dazu gehörten neben der bereits erwähnten Errichtung des ersten Opernhauses vor allem die Aufrüstung und Modernisierung der Armee, Steuerreformen, die Industrialisierung, der Ausbau der Eisenbahn und der im Zusammenhang mit »Aida« vielzitierte Bau des Suez-Kanals – dessen globale Bedeutung erst kürzlich wieder ins Bewusstsein geriet.
Für die Eröffnung des Opernhauses 1869 wünschte sich Ismael Pascha von Giuseppe Verdi eine Eröffnungshymne. Verdi lehnte etwas ruppig mit der Bemerkung ab, »Gelegenheitstücke« seien nicht seine Sache. Also wurde das Opernhaus (kurz vor der Eröffnung des Suez-Kanals) mit »Rigoletto« eingeweiht. Ismail Pascha aber, immer noch glühender Verehrer Verdis, ließ nicht ab und Anfang 1870 wurde Camille Du Locle in seinem Namen von neuem bei Verdi vorstellig. Der französische Archäologe (und Begründer des Ägyptischen Museums in Kairo) Auguste Mariette hatte bereits die Grundlinien zu einer Oper entworfen, die auf Wunsch des Vizekönigs ägyptische Themen verarbeiten, zu einer pompösen Aufführung taugen und überdies reichlich Lokalkolorit enthalten sollte. Gegenüber so viel durchsichtigem Kalkül blieb Verdi zunächst weiterhin skeptisch und räumte rundweg ein, zur ägyptischen Kultur nie eine besondere Affinität verspürt zu haben! Erst als, wie Verdi schrieb, eine Sondierung der »pekuniären Verhältnisse Ägyptens« günstige Resultate zeitigte und seine Honorarforderung von sensationellen hundertfünfzigtausend Franken anstandslos akzeptiert wurde, lenkte er ein – wohl auch deshalb, weil man listig hatte durchblicken lassen, man würde sich andernfalls genötigt sehen, Charles Gounod oder gar Richard Wagner zu verpflichten.
Als Verdi dann aber im Mai 1870 Auguste Mariettes »programma egiziano« in den Händen hielt, lösten sich seine Bedenken in Luft auf und nun ging es Schlag auf Schlag: Bereits am 2. Juni schrieb er an seinen Verleger, er könne »einen reichlich ausgearbeiteten Opernentwurf« vorlegen. Für die Textarbeit wurde Verdis Wunschkandidat Antonio Ghislanzoni gewonnen, der ihm schon für »La forza del destino« zur Seite gestanden hatte, und im Sommer begann die Kompositionsarbeit. Dabei ging Verdi umsichtig vor und informierte sich im Verlauf der Arbeit über historische, religiöse und selbst topografische Details. Er nahm regen Anteil an der Entstehung des Librettos und legte sein Hauptaugenmerk auf dramatische und emotionale Dichte sowie auf stringente Charakterzeichnung. Und während die Arbeit rasch voranschritt, wurden parallel dazu in Paris unter der Leitung von Auguste Mariette Bühnenbild und Kostüme »in genauem ägyptischen Stil« – so wünschte es der ägyptische Vizekönig – gefertigt. Für den Großaufmarsch im zweiten Akt ließ Verdi sogar eigens Trompeten in gestreckter Form von Adolphe Sax entwickeln, die vor allem optisch wie altägyptische Instrumente wirken. Alles schien zur Uraufführung bereit, doch der Deutsch-Französische Krieg und die damit einhergehende Belagerung von Paris 1870 machten dem Opernprojekt einen Strich durch die Rechnung. Mariette durfte die französische Hauptstadt nicht verlassen, Ausstattung und Kostüme wurden beschlagnahmt und die Premiere musste um mehr als ein Jahr verschoben werden. Verdi nutzte die unfreiwillige Pause, um seine Komposition zu überarbeiten, und am 24. Dezember 1871 fand schließlich die erfolgreiche Uraufführung in Kairo statt.
Unübersehbar bündeln und spiegeln sich in dem Werk die verschiedenen Zeitströmungen und Interessen, die zum Entstehen der Oper beitrugen. Die Musik zollt den Bedürfnissen des Vizekönigs durch ägyptisches Kolorit seinen Tribut, der imperialistische Gestus der Ägypter gegenüber den »wilden Nubiern« ist überdeutlich, Pracht und Pomp der Staatsmacht werden breit ausgerollt. Dass daraus ein Werk mit »mehr Biss und Theatralik« wurde, liegt aber nicht an diesen vorderhand affirmativen Gesten dem Auftraggeber gegenüber. Sondern Verdi bedient sich, stärker noch als in »Don Carlo«, einer Dramaturgie, in der der einsame und vergebliche Kampf des Individuums gegen einen übermächtigen und letztlich anonymen Staatsapparat gezeigt wird; und wo aus dem Pathos des Kampfes um »Freiheit für alle« das Ringen um die zarte Flamme der »Liebe für zwei« wird – final erstickt unter den sich langsam absenkenden Grabplatten der bei lebendigem Leibe Eingemauerten.
Da schwingt Verdis alte Wut gegen das Establishment mit, sein Herzblut für die Außenseiter und Vergessenen, aber auch eine ganze Menge Desillusionierung gegen Ende eines langen Lebens- und Schaffensprozesses. Die politische Situation in Europa wie in seinem Heimatland Italien, die Kriege, die Entwicklung der Nationalstaaten, all das stimmte ihn nicht zuversichtlich. Als Kommentar zum Sieg der Deutschen bei Sedan über die Franzosen schrieb er: »Wir werden dem europäischen Krieg nicht entgehen, und er wird uns verschlingen. Er wird nicht morgen kommen, aber er kommt. Ein Vorwand ist schnell gefunden.« Die bittere Pointe ist dabei, dass diesem alles verschlingenden gesellschaftlichen Kriegszustand in »Aida« alle um ihre Individualität ringenden Personen – nicht nur die Sklavin Aida, sondern auch der erfolgreiche Heerführer Radamès wie die Tochter des Pharaos Amneris – zum Opfer fallen.
Die Dresdner Neuproduktion von Regisseurin Katharina Thalbach und ihrem langjährigen Bühnen- und Kostümbildner Ezio Toffolutti belässt »Aida« dort, wo Verdi die Oper angesiedelt hat: in einem imaginierten Ägypten der Pharaonen. Und so, wie es Giuseppe Verdi bei allem Interesse für die archäologischen Spuren nicht um eine Rekonstruktion altägyptischer Wirklichkeit ging, sondern um die konzise Darstellung von reflektierenden Macht- und Lebensverhältnissen, entwickeln Katharina Thalbach und Ezio Toffolutti vor uns ein Plädoyer für den Sieg der Liebe über die Kälte der Macht, des Traums über die Staatsraison und der Menschlichkeit über das Kalkül.
Johann Casimir Eule
kurz und bündig
kurz und bündig
Ausgezeichnet!
Die Semperoper Dresden freut sich über verschiedene Auszeichnungen beim 12. International Creative Media Award (ICMA): Die »Semper:Donnerstag«-Reihe auf den Social Media Kanälen der Semperoper wurde in der Kategorie »Social Media Projects« mit dem ICMA-Award in Silber ausgezeichnet. Die Plakate für »Drei miese, fiese Kerle« und »Blues-Brothers« wurden jeweils mit dem »ICMA-award of exellence« in der Kategorie »Poster« ausgezeichnet. Herzliche Glückwünsche allen Beteiligten!

Premiere
Premiere
Gegen das Vergessen
Im März feiert die Neuinszenierung von Udo Zimmermanns »Weiße Rose«, eine der meistgespielten zeitgenössischen Kammeropern, in Semper Zwei Premiere
Als am 18. Februar 1943 Joseph Goebbels’ »Sportpalastrede « durch die Radios schallte, flatterte von der Galerie des Lichthofes der Münchner Universität das sechste Flugblatt der studentischen Widerstandsgruppe »Weiße Rose« herunter. Die Botschaft: Nach der Katastrophe von Stalingrad dürfen die Deutschen nicht länger die Augen verschließen, und es ist höchste Zeit, sich gegen den Nationalsozialismus aufzulehnen. Noch vor Ort wurden die Mitglieder Hans und Sophie Scholl festgenommen und vier Tage später, unter dem Vorsitz des keifenden Präsidenten des Volksgerichtshofs, Roland Freisler, zusammen mit ihrem Freund Christoph Probst zum Tode verurteilt.
Der im November verstorbene Dresdner Komponist Udo Zimmermann setzte sich musikalisch gleich zweimal auf unterschiedliche Weise mit dem Schicksal der Widerstandsgruppe auseinander. In seinem ersten Werk, einer großangelegten Oper in acht Bildern und sieben Rückblenden mit insgesamt 14 Rollen, die 1967 im Opernstudio der Hochschule für Musik Dresden uraufgeführt wurde, standen die unterschiedlichen Phasen des politischen Widerstandes der gesamten Gruppe im Mittelpunkt. Rund 20 Jahre später widmete sich Zimmermann dem Stoff erneut, diesmal jedoch in Form einer intimen Kammeroper, in der er auf dokumentarisch angelegte Szenen und Handlungsstränge komplett verzichtete.
In 16 assoziativ auseinander hervorgehenden Szenen wird in »Weiße Rose« die Gedanken- und Gefühlswelt der inhaftierten Geschwister Scholl herausgestellt, die stellvertretend für die weiteren Mitglieder der Gruppe als einzige Figuren im Stück auftreten. »Ich war der Ansicht, wir müssten von dem historischen Fall der Scholls abstrahieren. Es geht um eine Geschichte mit zwei jungen Menschen, die vor ihrer Hinrichtung stehen, die eine psychisch-physische Grenzsituation erleben«, so Udo Zimmermann. In Rückblenden, Traumerzählungen und inneren Monologen erinnern sich die Geschwister in ihrer letzten Stunde an die Natur, an Begegnungen mit den Eltern und den Freunden, aber auch an schreckliche Erlebnisse an der Front und die Furcht davor, dass Kinder in die Deportation geschickt werden könnten. Keine heroischen Märtyrerfiguren zeigt Zimmermann in seiner Kammeroper, sondern zwei junge Menschen mit all ihren Ängsten, inneren Kämpfen und Zweifeln.
Für die kunstvolle Textcollage des Librettos arbeitete der Dramaturg und Autor Wolfgang Willaschek sowohl mit den handschriftlichen Aufzeichnungen und Briefen von Hans und Sophie Scholl als auch mit Texten aus der Bibel und Gedichten von Dietrich Bonhoeffer, Franz Fühmann und Tadeusz Różewicz. Udo Zimmermann zufolge war es wichtig, dass sich die Dramaturgie des Stückes von aller Opernkonvention löst und szenische Offenheit für Poesie, Traum und Utopie ermöglicht: »Die Grenzen zwischen Realität und Irrealität bleiben fließend. Das Werk sollte keine historische Rückschau liefern, sondern gleichnishaft unsere Zeit, unsere Haltungen und Überzeugungen in Frage stellen, Vergangenheit als Parabel der Gegenwart sein.« Für die Kammerfassung entschied sich Zimmermann für »klassische« Orchesterinstrumente, denen er jedoch ungewohnte Farben entlockt. Weiche Klänge von Altflöte und Streichern wechseln sich ab mit extremen Intervallsprüngen und harten Akkorden, die gleich zu Beginn des Stückes an das Geräusch einer Guillotine erinnern.
Inszenieren wird Zimmermanns Kammeroper der Schweizer Regisseur und Bühnenbildner Stephan Grögler, die Musikalische Leitung liegt in den Händen von Johannes Wulff-Woesten. »Wir freuen uns sehr, Udo Zimmermanns Kammeroper ›Weiße Rose‹ nach der Dresdner Erstaufführung im Kleinen Haus 1987 und der letzten Vorstellung 1989 nun endlich wieder spielen zu können. Zimmermann hat für diese Stadt eine große Bedeutung, er wurde hier geboren, war Mitglied im Kreuzchor und hat sowohl für die Musikhochschule als auch für die Staatsoper durch sein Wirken viel erreicht. Er war eine Identifikationsfigur für die Neue Musikszene, und das Musiktheater des 20. Jahrhunderts war ihm immer besonders wichtig«, erklärt Johannes Wulff-Woesten. Stephan Grögler, der die Kammeroper bereits in Frankreich und der Schweiz inszeniert hat, wird das Stück in Semper Zwei in einem von ihm entworfenen Bühnenbild neu entwickeln: »Wir haben für Semper Zwei eine Raumsituation geschaffen, in der das Publikum zwischen den Sänger*innen auf der Szene und mit dem Orchester im Rücken sitzen wird. Zimmermanns besonderes Klangspektrum wird also unmittelbar zu erleben sein, und die Zuschauer*innen sind mittendrin im Geschehen.«
Bianca Heitzer
kurz und bündig
kurz und bündig
Rückkehr des Tanzes
Bereits zum zweiten Mal choreografierte der Halbsolist des Semperoper Ballett Houston Thomas ein Stück in Zusammenarbeit mit der seiner tänzerische Ausbildungsstätte School of American Ballet und dem renommierten New York City Ballet. Zu der Musik »El Chan« von Bryce Dessner vertanzt er in einem vierteiligen Werk mit dem Titel »The Return Studies« die Rückkehr der Tänzer*innen auf die Bühne nach der langen Zwangspause durch die Pandemie.

Premiere
Im Zentrum von Giacomo Puccinis Tragedia giapponese »Madama Butterfly«, die in Nagasaki zu Beginn des 20. Jahrhunderts spielt, steht die junge Geisha Cio-Cio-San, genannt »Butterfly«. Der US-amerikanische Marineleutnant Pinkerton schließt mit Cio-Cio- San – nach damals in Japan möglicher Praxis – eine Kurzzeitehe und mietet für den geplanten Aufenthalt gleich das passende Häuschen mit dazu. Während für Pinkerton die Liaison als befristetes Erotikvergnügen geplant ist, bedeutet sie für Cio-Cio-San die Liebe ihres Lebens. Sie konvertiert zum Christentum, bricht mit ihrer Familie und wartet nach Pinkertons Heimreise beharrlich mit dem gemeinsamen Sohn auf die versprochene Wiederkehr. Tatsächlich kommt Pinkerton nach drei Jahren zurück. Allerdings zusammen mit seiner amerikanischen Ehefrau Kate, bereit, seinen Sohn mit nach Amerika zu nehmen … Eine Enttäuschung, auf die Cio-Cio-San mit dem Freitod reagiert: »Ehrenvoll sterbe, wer nicht länger mehr leben kann in Ehren.«
Auch wenn »Madama Butterfly« heute zu den beliebtesten Opern weltweit zählt, so stand doch am Anfang ein Uraufführungsmisserfolg sondergleichen. Und tatsächlich mag es auch heute schwerfallen, der Liebesgeschichte zwischen dem erst 15-jährigen Mädchen und dem amerikanischen Marineleutnant, der mit der gleichen imperialen Geste in den Hafen von Nagasaki einfährt, wie er das Mädchen »auf Zeit« heiratet, schwängert und wieder verlässt, vorbehaltlos zu folgen. Aber wie kam Giacomo Puccini überhaupt dazu, zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts eine Oper über eine japanische Geisha zu schreiben? Nach seinem grandiosen Erfolg mit »Tosca« im Januar 1900 war der Komponist schon bald wieder auf der Suche nach neuen Stoffen. Während eines Aufenthalts in London besuchte er John Belascos Theaterstück »Madame Butterfly« in englischer Sprache. Puccini soll zwar nicht viel verstanden haben, aber zumindest so viel, dass er die enorme Operntauglichkeit erkannte. Und so fing er nach Einholung der Rechte sofort an, zusammen mit Giuseppe Giacosa und Luigi Illica das Libretto zu erstellen. Mit beiden hatte er bereits »La bohème« und »Tosca« erarbeitet, die Zeichen standen also auf Erfolg.
Was Puccini an dem Stoff so außerordentlich reizte, war sicherlich, dass er in Cio-Cio-San jenen Frauentypus wiederfand, der ihn – sei es in Gestalt von Manon Lescaut, Mimì, Suor Angelica oder Liù – am meisten musikalisch inspirierte. Es sind die jungen, naiven, hingebungsvoll liebenden Frauen, die um ihrer Liebe willen tragisch sterben … In der Opernterminologie wurde für diese besondere Form der »femme fragile«, später der Begriff der »donna pucciniana« entwickelt. Vor allem aber spürte Puccini intuitiv die hoch spannende Mischung aus Exotik, Erotik und Gegenwartsbezug, die dem Stoff später nicht nur auf den Bühnen Europas zu solcher Wucht verhelfen sollte. Denn natürlich steht hier auch mit einem blutjungen Mädchen in asiatischem Gewand eine europäische Männerfantasie auf der Bühne, die stellvertretend für alle Opern-Besucher von B. F. Pinkerton hingebungsvoll für ihre erotische Andersartigkeit und schmetterlingshafte Zerbrechlichkeit bewundert wird. Neben den erotischen und sexuellen Bezügen sollten aber auch die politischen deutlich machen, dass es hier um Gegenwärtiges geht. Hatten doch die USA erst Mitte des 19. Jahrhunderts durch ihre sprichwörtliche Kanonenboot-Politik die Öffnung Japans für den Handel mit dem Westen erzwungen. Die Hafenstadt Nagasaki war hierfür das Einfallstor. Japan selbst befand sich nach langer Zeit der bewussten Abschottung in einem rasanten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Transformationsprozess, der u.a. in den japanisch- chinesischen Krieg (1894-1895) mündete und beispielhaft den Anspruch Japans auf seine regionale Vormachtstellung deutlich machte. Die Welt war also sichtlich in Bewegung; der Vorschein dessen, was wir heute Globalisierung nennen, machte sich auch mit seinen kulturellen Konflikten bemerkbar. Und Giacomo Puccini legte sowohl in der Anlage der Komposition, der Instrumentierung und der Entwicklung einer »veristischen« Couleure locale großen Wert darauf, im Rahmen des Opern-Möglichen die dargestellte Wirklichkeit mit einem Höchstmaß an emotionaler und sozialer Genauigkeit wiederzugeben. So traf er sich mit einer japanischen Schauspielerin, die auf Theatertournee in Europa war, um vom Klang japanischer Frauenstimmen zu erfahren, und suchte den Kontakt zur Frau des japanischen Botschafters in Italien. Sie vermittelte ihm Einblicke in die japanische Kultur und Gesellschaft, machte ihn mit japanischen Volksliedern vertraut und versorgte ihn mit Literatur. Vor allem aber wusste sie von einer Geisha zu berichten, die ein ähnliches Schicksal erlitten hatte wie Cio-Cio-San. Und so stellte Puccini schließlich die Oper im Dezember 1903 fertig. Was konnte schiefgehen? Offensichtlich alles.
Die Uraufführung am 17. Februar 1904 an der Mailänder Scala geriet zum unerwarteten, großen Fiasko. Das Mailänder Premierenpublikum reagierte auf den exotischen Spielort, die Drastik der Handlung, die nüchterne bis unbarmherzige Zeichnung vor allem von Pinkerton befremdet bis brüskiert. Immer wieder wurden Szenen lauthals karikierend kommentiert, lachte das Publikum schallend. Es kam zu tumultartigen Szenen, die lokale Presse verriss das Werk.
Giacomo Puccini selbst reagierte auf das Debakel mit Trotz: »Meine Butterfly bleibt, was sie ist. Die empfindungsreichste Oper, die ich je geschrieben habe! Ich werde noch gewinnen ... «, aber auch mit Einsicht in die Schwächen des Werkes. Er veränderte Cio-Cio-Sans Auftritt musikalisch, milderte die Passagen im Libretto, die zu deutlich auf die Herablassung des Amerikaners und die Kälte seiner Frau Kate fokussiert waren, und komponierte vor allem für B. F. Pinkerton selbst eine zusätzlich Arie – »Addio fiorito asil« –, die es auch ihm ermöglichen sollte, Reue und Einsicht und tief empfundene Liebe zu artikulieren. Das Nacharbeiten zeigte den gewünschten Effekt: Bereits wenige Wochen später, am 28. Mai 1904 im Teatro Grande in Brescia, wurden Komponist und Oper vom Publikum begeistert gefeiert. »Madama Butterfly« konnte ihren Siegeszug durch die Welt antreten.
Für den nun in Dresden inszenierenden Regisseur Amon Miyamoto, der sich detailliert mit den historischen Hintergründen der Oper und deren Figurenkonstellation auseinandergesetzt hat, ist die schicksalhafte Liebe, die entgegen aller Wahrscheinlichkeit beide Figuren der Oper zueinander erfasst, der Dreh- und Angelpunkt seiner Interpretation. Eine Liebe, die freilich zum Scheitern verurteilt ist: Hier die mittellose junge Geisha, die vergeblich, aber mit großer Energie versucht, der Enge ihrer patriarchalen und rückwärtsgewandten Gesellschaft zu entkommen, dort der Amerikaner, dem es angesichts des Rassismus in seinem Heimatland nicht möglich wäre – und der auch offensichtlich noch nicht reif dafür ist – gemeinsam mit Cio-Cio-San nach Amerika zurückzukehren. Eine Liebe, die aber den Keim zur Überwindung der sozialen und kulturellen Unterschiede in sich trägt. Und so erzählt Amon Miyamoto »Madama Butterfly« aus der Rückschau eines todkranken und reuevollen Pinkerton, der dem gemeinsamen und inzwischen erwachsenen Sohn von der Geschichte der tragischen Liebe seiner Eltern und damit auch seiner eigenen Herkunft erzählt.
Johann Casimir Eule
The blues are the roots and the other music are the fruits.
WILLIE DIXON
Premiere
Die Blues Brothers drehen auf
Für Semper Zwei haben Manfred Weiß und Max Renne den Film »Blues Brothers« adaptiert. Eine musikalische Zeitreise mit Songs zwischen Blues, Soul und Funk
Was ist das eigentlich, der Blues? Ist der Blues eine historische Musikform, entstanden in den 1920er Jahren in den amerikanischen Südstaaten? Ist der Blues ein Song mit einem bestimmten harmonischen Schema? Ist der Blues immer langsam und traurig? Oder ist der Blues ein Lebensgefühl, eine Einstellung zur Welt, die an jedem Ort der Welt gelebt werden kann?
Für alle, die den Film »Blues Brothers« kennen und lieben, ist klar: Blues, das ist die Musik, die die Brüder Jake und Elwood Blues mit ihren Freunden machen. Der Film, der 1980 in die Kinos kam und seitdem Kult-Status genießt, ist ein wahres Defilee von Showgrößen wie Aretha Franklin, James Brown, Cab Colloway oder Ray Charles. Die Musik der damaligen Gast-Stars, der Blues, war ein wenig aus der Mode gekommen, und durch den Film erlebten all die Show-Größen ein furioses Comeback. Die Geschichte der Blues Brüder, die die Schulden ihres alten Waisenhauses bezahlen wollen und dafür ihre längst verstreute Band wieder zusammentrommeln, kommt nun als rasantes Musical auf die Bühne von Semper Zwei.
ROAD-MOVIE MIT HITS
Der Film »Blues Brothers« ist ein Road-Movie mit einer episodenartigen Handlung: Nach und nach suchen die Brüder Jake und Elwood Blues die Mitglieder ihrer Band auf, die sich längst in bürgerlichen Berufen eingerichtet haben. In jeder Episode wird ein Song gespielt – und am Ende hat die Band ein Mitglied mehr. Aber bei ihrer Fahrt durch das Umland von Chicago ziehen die Blues Brothers bald eine Spur von Verfolgern hinter sich her: die Polizei, dann eine Truppe von Neonazis und außerdem eine geheimnisvolle Frau mit einem Gewehr …
Wie passt ein Road-Movie mit langen Verfolgungsfahrten auf eine Theaterbühne? Regisseur Manfred Weiß hat für die »Blues Brothers« einen erzählerischen Kniff gefunden: Die Blues Brothers tingeln nicht wie im Film durch die Vororte von Chicago, sondern landen auf ihrer Suche nach den alten Band-Genossen ausgerechnet in einem Musiklokal der DDR. Dort allerdings wird statt der offiziell angekündigten sozialistischen Schlagermusik der Blues gepflegt. Was für ein Zufall! Und während der ursprüngliche Blues die Musik der Schwarzen war, ist der Blues hier eine Art Geheimcode. Mit den Worten des Blues-Forschers Paul Oliver: »Für diejenigen, die den Blues hatten, für die, die den Blues lebten, für die, die mit dem Blues lebten, hatte der Blues einen Sinn. Aber denen, die außerhalb des Blues lebten, entzog sich seine Bedeutung.« Manfred Weiß versteht diese Version der »Blues Brothers« als eine Hommage an die sehr lebendige Blues-Szene der DDR – und nicht zuletzt an die überwältigende, leidenschaftliche und listige Kraft der Musik. Okarina Peter und Timo Dentler haben für »Blues Brothers « eine Lokalität der 1980er Jahre gebaut, die eine kleine Zeitreise in die letzten Jahre der DDR ermöglicht.
WAS IST DER BLUES?
Und was genau ist nun der Blues? Max Renne, Musikalischer Leiter der »Blues Brothers«, erläutert: »Der ursprüngliche Blues aus den 1920er/30er Jahren hat immer vom Leid erzählt und war deshalb auch immer slow. In ›Blues Brothers‹ gibt es klassische Blues-Nummern wie ›Minnie the Moucher‹, aber wir spielen natürlich auch Upbeat-Songs. Einige, wie ›Sweet Home Chicago‹ oder das ›Peter Gunn Theme‹, funktionieren nach dem Blues- Schema. Andere Nummern würde ich eher unter Funk and Soul einordnen, wie ›Think‹ oder ›Gimmi some lovin‹.« Blues ist kein einfacher Musikstil, er ist ein Lebensgefühl. »Die meisten Songs aus dem Film würde man heute eher als Soul bezeichnen«, kommentiert Max Renne. »Wir spielen die Songs aus dem Film und dann einige Nummern von DDR-Bluesern, wie den ›Reichsbahn-Blues‹, das ist ein klassischer Blues. Aber wir spielen auch ›Ich glotz’ TV‹ von Nina Hagen, das würde ich eher einen Schlager nennen.«
Für den richtigen Sound sorgt eine Rock- Blues-Band mit Klavier und Hammondorgel, Bass, Gitarre und Schlagzeug. Den besonderen Klang aber erzeugen die Bläser: Trompete, Saxophon und Posaune machen mit prägnanten Einwürfen ordentlich Dampf. »Ohne Bläser funktionieren die ganzen Nummern nicht«, kommentiert der Musikalische Leiter Max Renne.
Kai Weßler
Probenblick
Probenblick
Semperoper Ballett
Die Tänzer*innen des Semperoper Ballett trainieren an sechs Tagen in der Woche; auf die Classes folgen bis zu sechs Stunden Proben. Bis die einzelnen Partien auf der Bühne zusammenkommen, feilen die Solist*innen und das Corps de Ballet getrennt voneinander an einzelnen Pas de deux und Szenen, perfektionieren ihren Ausdruck und ihre Technik.








Freitext
»Lügende Tränen«
»Bei Männern, bei Soldaten, suchet Ihr ein treues Herz? Ach, das lasset doch ja niemand hören! Alle aus gleichem Stoff sind diese Männer; flatterndes Espenlaub, wechselnde Winde«, versucht die Zofe Despina die Schwestern Fiordiligi und Dorabella zu erheitern, deren Verlobte augenscheinlich in den Krieg ziehen müssen, und möchte sie zu neuen Abenteuern ermutigen: »O, den Barbaren ist Mitleiden fern. Lasst uns mit gleicher Münze bezahlen, diesen Abscheulichen all’ diese Qualen, lasst uns auch sie nur lieben zum Spaß! Ja, nur aus Eitelkeit, ja nur zum Spass!«
Wolfgang Amadeus Mozart, »Così fan tutte«
Oper
Oper
Mozart-Tage 2022 mit Omer Meir Wellber
In diesem Jahr steht die Zusammenarbeit zwischen Wolfgang Amadeus Mozart und seinem Librettisten Lorenzo Da Ponte im Mittelpunkt eines musikalischen Oster-Wochenendes in der Semperoper
»Ich machte mich ans Werk …, im selben Tempo, wie ich die Wörter niederschrieb, setzte Mozart sie in Musik. In sechs Wochen hatten wir es geschafft.« Mit diesen Worten beschrieb Lorenzo Da Ponte 1786 seine Zusammenarbeit mit Wolfgang Amadeus Mozart an »Le nozze di Figaro«, der ersten der drei gemeinsamen Opern. Weitere vier Jahre sollte diese Zusammenarbeit, die eine der Genre-prägendsten in der Musikgeschichte ist, andauern. Der Venezianer Lorenzo Da Ponte gehörte zu den interessantesten Künstlerpersönlichkeiten des ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts. Er schrieb über 30 Opernlibretti, war Dichter, Priester und Freigeist in einer Person. Er wanderte schließlich nach Amerika aus und erzählte sein abenteuerliches Leben in seinen Memoiren, die noch heute die wichtigste biografische und musikgeschichtliche Quelle für die Zusammenarbeit mit Mozart darstellen.
Am Osterwochenende 2022 präsentiert die Semperoper von Freitag- bis Sonntagabend Wolfgang Amadeus Mozarts drei »Da Ponte-Opern« in hochrangiger Sänger*innenbesetzung und unter der Musikalischen Leitung von Mozart-Spezialist Omer Meir Wellber, dem Ersten Gastdirigenten der Semperoper. 2014 hatte der Zyklus in der Regie von Andreas Kriegenburg mit »Così fan tutte« begonnen, wurde 2015 mit »Le nozze di Figaro« in der Regie von Johannes Erath fortgesetzt und fand 2016 mit Andreas Kriegenburgs Inszenierung von »Don Giovanni« seinen fulminanten Abschluss. Alle drei Produktionen studierte Omer Meir Wellber damals ein und prägte die musikalische Ästhetik in enger Zusammenarbeit mit den Regisseuren entscheidend mit.
Im Begleitprogramm der Opernaufführungen stehen neben der Beleuchtung des Autorenpaares Mozart/Da-Ponte vor allem die politisch-gesellschaftlichen Zeitumstände und die musikalische Landschaft in Wien zum Ende des 18. Jahrhunderts im Mittelpunkt. Diese kennt Da Ponte neben seiner Tätigkeit für Mozart als einer der gefragtesten Librettisten der Musikstadt. In der Matinee »Der Mann an Mozarts Seite« am Samstagvormittag präsentieren Mitglieder des Ensembles der Semperoper Arien und Ensembles aus Opern von den Mozart-Zeitgenossen Antonio Salieri und Vicente Martin y Soler auf Texte von Lorenzo Da Ponte.
Am Samstagnachmittag lädt dann der renommierte Musikwissenschaftler und Mozartexperte Laurenz Lütteken im Rundfoyer der Semperoper zum Vortrag zu einem der spannendsten Themen, das den drei Mozart-Da-Ponte-Opern zugrunde liegt, ein: Den Kontext der Aufklärung im Wien Kaiser Josephs II. Der Kaiser, der die Vertonung des Skandal-Stückes »Figaros Hochzeit« persönlich genehmigen musste und der angeblich den Anstoß zu »Così fan tutte« gegeben hatte, verfolgte eine rigide Politik der Reform und der »Aufklärung von oben«. Am Sonntagvormittag dann und vor dem Abschluss des Opernzyklus’ kommt der Musikalische Leiter der drei Produktionen Omer Meir Wellber im Gespräch mit dem Journalisten Robert Braunmüller zu Wort. Er berichtet an diesem musikalisch umrahmten Vormittag von seiner Beziehung zu Mozart und der Arbeit am Zyklus dieser drei besonderen Opern in Dresden.
MOZARTSTADT DRESDEN
Apropos: Mozart selbst hat Dresden nur einmal besucht und das war im Jahr 1789 und ausgerechnet zu Ostern. Mit seinem Freund Fürst Karl Lichnowsky war er auf dem Weg nach Berlin und nahm zwischen dem 12. (Ostersonntag) und 18. April Quartier in Dresden. Er hinterließ Spuren: Die Quellen berichten u.a. von Konzertbesuchen in der Katholischen Hofkirche und dem Hoftheater, Besuchen bei hochgestellten Dresdner Familien und Diplomaten und einem Vorspiel bei Kurfürst Friedrich August im Dresdner Schloss. Übrigens ist bei diesem Aufenthalt auch das bekannte Silberstift-Portrait von Mozart von Dorothea Stock, das als eines der feinsten und kleinsten Portraits des Meisters gilt, entstanden.
Juliane Schunke
Staatskapelle

Staatskapelle
Sternenfall
Mit einem Doppelkonzert des Capell-Compositeurs und Schostakowitschs letzter Symphonie kehrt Vladimir Jurowski im 7. Symphoniekonzert an das Pult der Staatskapelle zurück
Die Auseinandersetzung mit konkreten Klangereignissen steht für Matthias Pintscher, den Capell-Compositeur der Spielzeit 2021/22, im Zentrum seiner kompositorischen Arbeit. Sein Ziel ist dabei nicht etwa »Dinge aufs Papier zu bringen, die besonders originell aussehen«, sondern musikalische Räume zu gestalten, die sich im Hören entfalten. Das gilt auch für sein 2012 entstandenes Konzert »Chute d’Étoiles « – zu Deutsch: Fall der Sterne – für zwei Trompeten und Orchester, das im 7. Symphoniekonzert der Staatskapelle unter der Leitung von Vladimir Jurowski nun auch in Dresden zu erleben sein wird.
Hinter den massiven orchestralen Klangballungen, mit denen das Werk anhebt, steht eine ungewöhnliche Inspiration: die großangelegte Installation »Sternenfall « des deutschen Künstlers Anselm Kiefer, in der riesige Skulpturen aus miteinander verschmolzenen Bleiplatten eine Hauptrolle spielen. »Es ist die Bildwerdung eines Infarktes, eines Zusammenbruches«, beschreibt Pintscher die Pariser Installation Kiefers. »Vielleicht kann man sogar so weit gehen zu sagen, es ist der Zusammenbruch der Welt, der Zusammenbruch eines Zustandes, und in dieser Fraktur, diesem Infarkt, in diesem Riss wohnt der Beginn des Neuen, die Rekonstitution, die Reanimation.« Der orchestrale Ausbruch zu Beginn wird zur Quelle der Komposition: »Aus der Wucht des Eklats lösen sich einzelne Partikel, die dann in einen konzentrierten Modus geführt, verwandelt, durchgeführt werden und zum Schluss quasi wieder in sich zurückfinden.« Den Einsatz der Solotrompeten nach dem Beginn vergleicht Pintscher mit dem »Öffnen von zwei Ventilen eines riesigen Instrumentes aus Blei, das sich Luft verschafft, in sehr ziselierter und konziser Form«.
Pintschers Klangskulptur steht mit Dmitri Schostakowitschs Symphonie Nr. 15, die vor 50 Jahren uraufgeführt wurde, ein Höhepunkt aus dem Spätwerk des russischen Komponisten und eine seiner ungewöhnlichsten Symphonien gegenüber. Sie besticht durch eine Fülle von Anklängen an eigene ebenso wie an fremde Werke und trägt damit Züge eines musikalischen Gedächtnisses. So zitiert etwa der erste Satz aus der Ouvertüre zu Gioacchino Rossinis »Guillaume Tell«, das Finale dagegen aus Richard Wagners »Der Ring des Nibelungen« und »Tristan und Isolde«. Auch wenn die inhaltliche Deutung mancher Anspielungen noch heute Rätsel aufgibt, so ist doch unverkennbar, dass seine letzte Symphonie für den bereits schwerkranken Schostakowitsch auch ein persönliches Resümee ist. Die im Kontrast zu seinen frühen Symphonien geradezu kammermusikalische Behandlung des Orchesters, aus dem immer wieder Instrumente solistisch hervortreten, verleiht der Rückschau eine besondere Intimität. Eine autobiografische Bilanz, die eher Selbsthinterfragung als Selbstvergewisserung ist und zugleich symphonisches Neuland betritt.
Christoph Dennerlein
Abgestaubt
Abgestaubt
Gut gerüstet
In den »Semper!«-Ausgaben dieser Spielzeit »entstauben« wir für Sie ein seltenes, historisches Fotokonvolut und geben Einblick, wie wir verblassender Geschichte detektivisch »auf die Schliche« kommen …
Heerführer in schmuckvoller Rüstung, einsatzbereite Waffen zahlreicher Krieger und ein Handschlag von bedeutender Tragweite: Worum geht es auf diesem Bild?
In den drei jüngsten Episoden der »Abgestaubt- Reihe« untersuchten wir vor allem die äußere Beschaffenheit des zu erschließenden Fotokonvolutes. Formale Kriterien wie Material, Größe und Zustand der Fotos bzw. besondere Kennzeichen des Prägestempels halfen uns, das Aufnahmedatum des Materials auf die 1920er/30er Jahre einzugrenzen und die Fotografin Ursula Richter als Urheberin der Fotoserie auszumachen.
In dieser Ausgabe soll es darum gehen, von der inhaltlichen Aussage der Fotos auf das abgebildete Werk zu schließen. Dieser Vorgang gleicht in vielen Fällen einer Recherche, die mit detektivischem Gespür sämtliche semantische Indizien mit einbezieht und bei der ästhetisches Einschätzungsvermögen sowie Repertoirekenntnisse vonnöten sind.
Erinnern wir uns an die unterschiedlichen szenischen Konstellationen, die uns die Fotos der vergangenen Ausgaben dieser Reihe veranschaulichten. Auf einem der Fotos tanzten malerisch choreografierte Damen in symmetrischen Reihen über die Bühne, auf einem anderen reckten dämonische Hexenwesen bedrohlich die Arme in die Höhe. Da bei beiden Fotos der szenische Fokus auf der ästhetischen Bewegung lag, wäre die Vermutung naheliegend, dass es sich um eine Ballettaufführung handeln könnte. Allerdings kann diese These mit der Einbeziehung des hier abgebildeten Fotos eindeutig widerlegt werden. Denn das Werk weist ein großes, dramatisch agierendes Opernensemble auf: Damenund Herrenchöre sowie zwei heroisch im Zentrum des Geschehens stehende Sängersolisten, die optisch eher dem »schweren« Gesangsfach als dem grazilen Corps de Ballet zuzuordnen sind. Wir suchen also nach einer opulent ausgestatteten Oper, deren Handlung ästhetisch unterschiedliche szenische Situationen umfasst: heroisches Kriegsgeschehen, ein sorgenvolles Volk und gleichzeitig eine fantastische, überirdische Ebene, in der Hexen und Geistererscheinungen ihr Unwesen treiben. Die Antwort liegt zum Greifen nahe und tatsächlich bringt ein Blick in die Aufführungschronik der Staatsoper Dresden endlich Gewissheit: Es handelt sich um Giuseppe Verdis »Macbeth«! Diese Oper erlebte am 21. April 1928 im Semperschen Opernhaus ihre Deutsche Erstaufführung – fast ein halbes Jahrhundert, nachdem sie in Paris aus der Taufe gehoben wurde. Unter der Musikalischen Leitung von Hermann Kutzschbach und in der Inszenierung von Otto Erhardt feierte die Produktion große Erfolge und war ein wichtiger Beitrag zur überregional wahrgenommenen »Verdi-Renaissance «. Im Dresdner Anzeiger vom 23. April 1928 hieß es: »Wenn das Erneuerungswerk an Verdi überall auf solche Voraussetzungen gegründet ist, wie hier im Arbeitsbereich unserer Staatskapelle, so kann man für die Zukunft guten Glauben hegen.«
Mit dieser Erkenntnis fügen sich die Informationen schnell zu einem logischen Bild zusammen: Das Foto zeigt die Schlacht-Situation im Finale des vierten Aktes, unmittelbar nach der Tötung des Thronräubers Macbeth durch Macduff. Zum Zeichen der Treue reicht Macduff (Max Hirzel) dem neuen König Malcom (Guglielmo Fazzini) die Hand, umringt vom »geknechteten« Volk, das angesichts des neuen Herrschers sichtlich erleichtert aufatmet. Mit diesem entscheidenden Hinweis kann der inhaltliche Erschließungsprozess weiter an Fahrt aufnehmen und wir sind an Informationen »gut gerüstet« für die nächste und letzte Ausgabe der Reihe »Abgestaubt« für diese Spielzeit.
Katrin Rönnebeck
Education
Education
Tanz mal!
Maud Butter sucht die Tanz-Talente von morgen

»Tanzen ist wie fliegen!«, »Wenn ich tanze, fühle ich mich frei« oder »Tanz lässt die Seele sprechen«. Viele Menschen genießen die Bewegung zur Musik, dennoch braucht es für viele junge Tanzbegeisterte oft noch einen Impuls von außen, um den Versuch zu wagen, das Tanzen zum Beruf zu machen.
Um Mädchen und Jungen zu ermöglichen, sich im Tanz auszuprobieren und auf eine professionelle Tanzkarriere vorzubereiten, geht seit vielen Jahren die Tanzpädagogin Maud Butter im Auftrag der Palucca Hochschule für Tanz Dresden als Talentscout von Grundschule zu Grundschule. Sie weiß, worauf es ankommt, wenn junge Menschen einer Tanzkarriere entgegenblicken.
Von Januar bis Mai im Dresdner Umland und von Mai bis Dezember im Stadtgebiet besucht sie nahezu alle dritten beziehungsweise vierten Klassen im Sportunterricht. Dort verschafft sie sich nach einer kurzen Aufwärmung und darauffolgend einigen einfachen Übungen einen Eindruck über die Beweglichkeit und Koordination, die Musikalität und das Auftreten der Kinder. Bereits wenn die Schüler*innen den Raum betreten, merkt sie, ob sie voller Bewegungsdrang sind und mit welcher Intensität sie ihre Bewegungen ausführen. Dieser erste Eindruck sei sehr wichtig, erklärt sie. Dank ihrer nunmehr 30-jährigen Erfahrung als Tanzpädagogin hat Maud Butter einen guten Blick dafür entwickelt, inwiefern die Jungen und Mädchen nicht nur körperlich, sondern auch psychisch für die Aufnahme an die Tanzhochschule geeignet sind. Bevor sie ausgewählte Schüler*innen zu den alljährlichen Eignungstests der Palucca Hochschule einlädt, spricht Maud Butter zudem mit dem Kind selbst und mit der jeweiligen Lehrkraft. Ihr ist es wichtig zu vermitteln, dass das Vortanzen an der Hochschule zwar eine große Chance darstellt, jedoch in keinster Weise verpflichtend ist. Mit den Sichtungen im Grundschulbereich hört ihr Tätigkeitsbereich jedoch nicht auf: Durch Vernetzung mit anderen Ballettschulen über das von der Palucca Hochschule gegründete »Netzwerk Tanztalente«, durch Fortbildungen für Sportlehrkräfte und durch weitere Projekte engagiert sie sich in verschiedenen Bereichen, um Kindern einen Zugang zum Tanz zu ermöglichen und sie auf ihrem Weg dahin zu unterstützen. Auch das Kooperationsprojekt »Tanz mal!« mit der Semperoper Dresden, das mit Beginn dieses Jahres in die dritte Runde geht, trägt dazu bei. Das Besondere daran: Die Schüler*innen erhalten im Rahmen eines 90-minütigen Workshops nicht nur erste Einblicke in die Welt des Balletts, sondern haben vor allem die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden. Über Alltagsbewegungen und bildhafte Erklärungen niedrigschwellig an den Tanz heranzuführen, ist Teil des Konzeptes. Von drei an der Palucca Hochschule ausgebildeten Tanzpädagog*innen angeleitet, lernen die Teilnehmer*innen, wie man sich durch Bewegung zur Musik ausdrücken kann. Mit dabei sind neben den Pädagog*innen und Tänzer*innen des Semperoper Ballett auch immer ein*e Korrepetitor*in und Maud Butter als Projektbeauftragte, gemeinsam mit Carola Schwab, Jugendreferentin der Semperoper. Auch Teil des Programms sind kurze Kostproben aus dem Bereich des zeitgenössischen Tanzes, anhand derer sich die Schüler*innen darin üben können, aufmerksam zuzuschauen und die Körpersprache anderer zu interpretieren. Die große Begeisterung, auf die »Tanz mal!« in den Schulen stößt und die zahlreichen Anmeldungen für die Eignungsprüfungen an der Palucca Hochschule nach den Besuchen von Maud Butter zeigen deutlich: Musik und Tanz als Ausdrucksmöglichkeit und Kommunikationsweise bereiten Freude und sind für die persönliche Entwicklung der Schüler*innen von großer Bedeutung.
Maite Herborn
Kontakt Carola Schwab, Tel +49 351 4911 456, E-Mail carola.schwab@semperoper.de
Mit freundlicher Unterstützung der Stiftung Kinderförderung von Playmobil
Zuschauerfrage
WORAUS BESTEHT DER »SCHNEE« IN DER »NUSSKNACKER«-INSZENIERUNG DES SEMPEROPER BALLETT?
Elisabeth Schröter-Kieß, Leiterin der Requisite, antwortet:
Für das »Schneewalzer«-Bild im »Nussknacker« verwenden wir Seidenpapier in einer Größe von 16x16 Millimetern. Dieses Papier zeichnet sich vor allem durch sein natürliches Flugverhalten und seine Lautlosigkeit aus, es raschelt also nicht. Zudem ermöglichen die Spitzenschuhe der Tänzerinnen ein gefahrloses Tanzen auf diesem Material. Um die Tänzerinnen mit der besonderen Situation vertraut zu machen, gibt es vor jeder Aufführungsserie immer auch noch einmal eine Bühnenprobe mit Schnee. Zu jeder Vorstellung rieselt übrigens neuer, »frischer« Schnee aus den zwei vorbereiteten Schneetüchern. Aus brandschutztechnischen Gründen darf nur Seidenpapierschnee mit einem B1-Zertifikat (Material schwer entflammbar) verwendet werden.
Sie fragen, wir antworten: Schicken Sie uns Ihre Fragen rund um die Semperoper per Post an Semperoper Dresden, Kommunikation & Marketing, Theaterplatz 2, 01067 Dresden oder per E-Mail an marketing@semperoper.de
Opernvogel

Opernvogel
Exotische Faszination
Diesmal präsentieren wir zur Premiere von »Madama Butterfly« einen echten Opernvogel und zugleich ein beliebtes wie ungewöhnliches Fotomotiv in der Vogelfotografie: den asiatischen Paradiesschnäpper. Und ist der Name schon illuster, so ist auch das Aussehen dieser Spezies ungewöhnlich: Sein glänzend schwarzer Kopf mit einer Haube, dazu der blaue Schnabel, vor allem aber die bis zu 30 Zentimeter langen Schwanzfedern verleihen dem 19 bis 22 Zentimeter großen Vogel ein besonderes, exotisches Aussehen. So exotisch-faszinierend, wie Cio-Cio-San auf den US-amerikanischen Marineleutnant Pinkerton gewirkt haben muss, dass er sich auf eine Liaison mit der jungen Geisha einließ – mit tragischem Ausgang … Der asiatische Paradiesschnäpper ist (anders als Pinkerton) in seinem Paarungsverhalten eindeutig so treu wie Cio-Cio- San: Er lebt monogam mit der/dem jeweils gewählten Partner*in zusammen und verteidigt den einmal gefundenen Nistplatz sehr energisch gegenüber anderen Brutpaaren. Seinen Lebensraum findet der asiatische Paradiesschnäpper in dicht bewaldeten Gebieten von Indien, Sri Lanka, der Mandschurei und in China.
Giacomo Puccini, »Madama Butterfly«
Lieblingsmoment
Lieblingsmoment
Seelenleben
Meine Lieblingsszene aus dem Ballett »Carmen« ist die Schlussszene, als Carmen erkennt, dass Don José beschlossen hat, sie zu töten. Während des Probenprozesses, in dem ich an einer passenden Verkörperung für meine Rolle arbeitete, habe ich versucht herauszufinden, wer Carmen wirklich ist, und jede Entscheidung nachzuvollziehen, die sie im Laufe der Handlung trifft. Als ich an der letzten Szene arbeitete, wurde die Figur Carmen endlich greifbar und mir klar, wie charakteristisch dieser Moment für ihr Leben und ihre Persönlichkeit ist. Die Art und Weise, wie sie sich mutig dem Tod entgegenstellt, zeigt, dass sie bis zur letzten Sekunde ihres Lebens nicht aufgibt, sich selbst treu bleibt. Das macht die Schlussszene für mich so wunderschön, obwohl es sich nicht um ein Happy End handelt. Außerdem liebe ich es, wie Johan Inger diese Szene gestaltet hat und damit die Interpretation ermöglicht, dass Carmens Seele niemals sterben wird. Ayaha Tsunaki, Halbsolistin des Semperoper Ballett
Johan Inger, »Carmen«

Premierenrezept
Premierenrezept »Blues Brothers«
Schnell und ostdeutsch
Der Grilletta
ZUTATEN
4 Brötchen, 250g gemischtes Hackfleisch, 30g Semmelmehl, ein Ei, eine kleine Zwiebel, Öl, 4 Esslöffel Letscho, Salz und Pfeffer
So wie die »Blues Brothers« eine eindeutig amerikanische Rhythm-and-Blues-Band waren, der gleichnamige Film ebenfalls ein eindeutig amerikanisches Produkt ist, so hat auch der Hamburger (gemeint ist hier natürlich das kulinarische Phänomen) seine Wurzeln im »Land der unbegrenzten Möglichkeiten«. Aber: Auch in der DDR gab es Rhythm-and-Blues-Bands, und es gab – und diesem wollen wir uns hier widmen – den »Grilletta«. Der »Grilletta« ist die ostdeutsche Variante des Hamburgers und wurde Anfang der 80er Jahre vom Rationalisierungs- und Forschungszentrum Gaststätten in Berlin entwickelt, um die Besucherströme auf dem Alexanderplatz mit schnellem Essen zu versorgen. Das hier beschriebene Grundrezept lässt sich natürlich mit Salat, Gurke, Käse und vielem mehr verfeinern, die Grundlage aber sind Hackfleisch, Brötchen und Letscho. Zunächst wird das Hackfleisch mit dem Semmelmehl, dem Ei, der fein gehackten Zwiebel, Pfeffer und Salz vermengt und zu vier flachen Frikadellen geformt. Diese werden in Öl gebraten und anschließend zwischen die getoasteten oder im Backofen erwärmten Brötchenhälften mit einem guten Esslöffel Letscho gegeben. Fertig ist der Grilletta! Und: Wie Letscho hergestellt wird, verraten wir vielleicht ein anderes Mal, zur Not gibt es das süß-saure Paprika-Gemüse auch fertig im Glas.
Susanne Springer
Kalender
Publikation

Publikation
»Semper!«-Archiv
Archiv der Ausgaben des »Semper!«-Magazins bis zur Spielzeit 2011/12